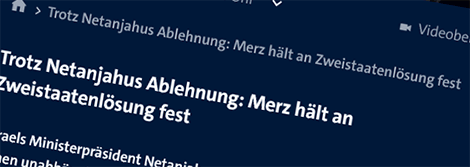Die Proteste der iranischen Bevölkerung gegen das Regime der Mullahs halten an. Zwar sollen sich zu den jüngsten Demonstrationen weniger Menschen versammelt haben als in der vergangenen Woche. Da das nach den brutalen Massakern der Schläger der Pasdaran kaum überraschen kann, wäre es allerdings wohl verfrüht, daraus ein baldiges Ende des Aufstands abzuleiten. Der Höhepunkt der Proteste ist noch längst nicht erreicht.
Denn so erschreckend die ja trotz aller Zensurmaßnahmen Teherans auch in der Islamischen Republik Iran kursierenden Opferzahlen auch sein mögen, bestätigen sie doch nur den menschenverachtenden Charakter der islamfaschistischen Tyrannei und die Notwendigkeit ihrer Überwindung. Zum Teil vermutlich von den Mullahs selbst gestreut, um von Protesten abzuschrecken, offenbaren sie doch zugleich die Verzweiflung des Regimes.
Die Protestierenden zeigen unterdessen ein feines Gespür dafür, auf wen sie ihre Hoffnungen setzen können. Ihre Rufe nach Freiheit gelten neben Reza Pahlavi, dem ältesten Sohn des 1979 von der islamistischen Revolte gestürzten Schahs, dem amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump und – ausgerechnet – dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu. Nach Ursula von der Leyens Team Europe, nach der Europäischen Union ruft niemand.
Die Menschen in der Islamischen Republik Iran wissen sehr wohl, was sie von der europäischen Beschwichtigungspolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gegenüber den Mullahs zu halten haben, und von wem sie tatsächliche Hilfe zumindest erhoffen können. Mit seiner Ankündigung, Unterstützung für sie sei »unterwegs«, hat sich der US-Präsident denn auch weit aus dem Fenster gelehnt. Hoffentlich halten er und seine Regierung Wort.